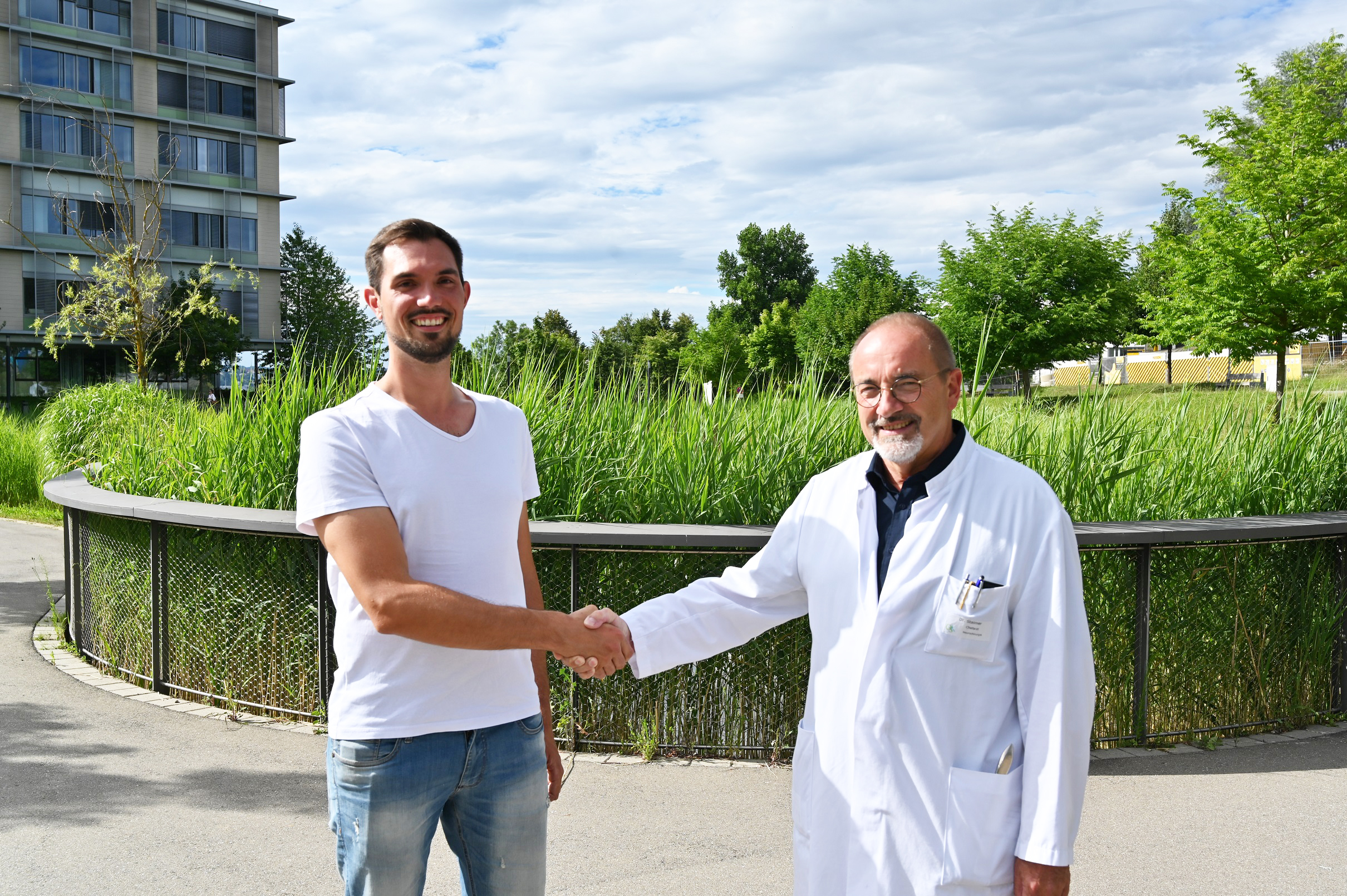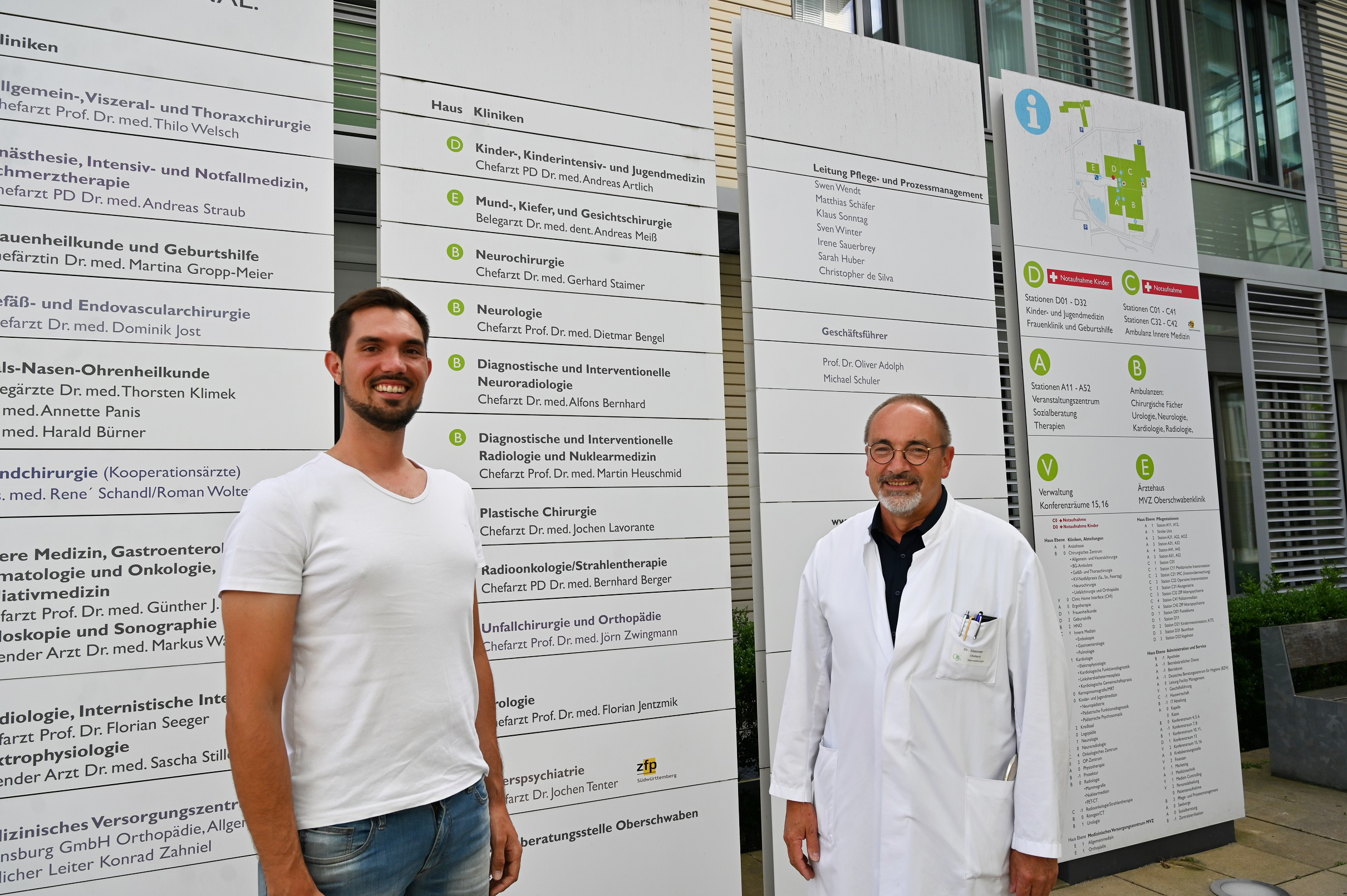„Plötzlich wurde mir klar, wie verbunden ich mit allem bin“
RAVENSBURG/SALEM – Mitten im tiefsten Winter wurde mir endlich bewusst, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt, sagte der französische Philosoph Albert Camus. Kein Satz passt besser zum Leben von Darius Braun. Der 35-Jährige aus Salem ist mit seiner Lebensgeschichte für viele Menschen in der Region Oberschwaben-Bodensee zum Vorbild geworden.
Als 14-Jähriger wäre er beinahe an einem tennisballgroßen Gehirntumor gestorben, der gegen den Hirnstamm drückte und bereits solche Ausfallerscheinungen verursachte, dass Darius Braun in der Schule gehänselt und gemobbt wurde, weil er plötzlich stotterte und schwankte wie ein Betrunkener. Für den Jungen, bis dato leidenschaftlicher Ruderer und Mitglied des Landeskaders, war es inmitten der Pubertät auch ein psychischer Alptraum.
Im St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg rettete ein Neurochirurgen-Team unter Leitung von Dr. Ioana Knöller und Dr. Benedict Fijen in einer achtstündigen Operation sein Leben. „Ein paar Tage später, und ich wäre womöglich ins Koma gefallen und gestorben. Ich werde der Oberschwabenklinik und dem EK ewig dankbar sein“, sagt Braun. Der Tumor lag, wie die Befunde der Neuroradiologie ergaben, im Bereich der hinteren Schädelgrube. Die Operation eines solchen Tumors erfolgt immer unter Sicht des Operationsmikroskopes. Nach Eröffnung der Haut und Spaltung der Muskulatur bohrten die Ärzte am EK Löcher in den Knochen der hinteren Schädelgrube und stanzten dann einen Knochenanteil weg – es entstand ein Defekt, der in der Neurochirurgie als Kraniektomie bezeichnet wird. Die Ärzte eröffneten die Hirnhaut und präparierten, bis sie auf den Tumor stießen, den sie sorgfältig Stück für Stück entfernten. „Man muss hier extrem vorsichtig und geduldig vorgehen, weil der Tumor in der Nähe des Hirnstamms liegt. Hier werden alle wichtigen Funktionen des Körpers gesteuert. Auch Hirnnerven und wichtige Gefäße müssen geschont werden und intakt bleiben“, sagt Oberärztin Dr. Knöller. Am Ende wurde der Knochendefekt mit einer aus einem speziellen Zement modellierten Plastik gedeckt. Schicht für Schicht wurde die Wunde wieder geschlossen. „Der Eingriff birgt natürlich Risiken“, sagt Dr. Knöller, „ist aber alternativlos.“
Auch Darius Brauns Leidenszeit war nach der Operation noch nicht vorbei. „Ich war anfangs linksseitig komplett gelähmt, konnte nicht mehr laufen, hatte Sprach- und Konzentrationsprobleme. Die Ärzte in der Reha meinten, ich könne froh sein, wenn ich den Hauptschulabschluss schaffe und mich irgendwann wieder bewegen kann.“ Doch der Junge, Sohn eines Lehrerehepaars, biss sich durch. Darius Braun legte nacheinander Haupt-, Realschul- und Gymnasium-Abschluss ab, obwohl ihn mit 17 ein lebensgefährlicher Sturz von einem Felsen, der eine fünfstündige Operation im EK nach sich zog, erneut empfindlich zurückgeworfen hatte. Danach absolvierte er ein PH-Studium in Weingarten und arbeitete an der Werksrealschule in Bad Waldsee als Lehrer. Ein imponierender Weg, der mit 30 allerdings ins Stocken geriet. Darius Braun erlitt einen Burnout, sein ganzes Leben stand wieder in Frage. Nachdem Dr. Gerhard Staimer, Chefarzt der Neurochirurgie am EK, bei einer MRT keine organischen Auffälligkeiten feststellte, beschloss Darius Braun, auf Sinnsuche zu gehen und sein gewohntes Hamsterrad zu verlassen. Er quittierte den Schuldienst und wagte das Abenteuer seines Lebens – eine Tour mit dem Fahrrad von Nord- nach Südamerika entlang der Panamericana, bei der er Spenden für die Deutsche Hirntumorhilfe sammelte.
509 Tage und 21 020 Kilometer lang war Darius Braun unterwegs, allein mit seinen Gedanken, Gefühlen, Rad und Gepäck (insgesamt 52 Kilo) und seinem Zelt, in dem er die Hälfte der Zeit übernachtete. Alle Höhen und Tiefen, die ein Menschenleben da Draußen mit sich bringt, erlebte er en passant. Und er lernte, auf Rückschläge gelassener zu reagieren. Etwa, als der Start der Tour in Vancouver erst einmal missglückte. Vier Wochen musste er auf sein Rad warten, das nicht mit im Flieger gewesen war. Oder, als er in San Francisco von einem Auto touchiert wurde.
Darius Braun lernte auch, dass es immer Lösungen gibt, wenn man sich selbst vertraut und offen für Hilfe ist. Als er in den Anden beschloss, an einem idyllischen Ort auf 4300 Meter Höhe sein Zelt aufzuschlagen und in der Nacht von 17 Grad Minus überrascht wurde, rettete er sich, indem er sich mit der ganzen Kleidung verhüllte, die er dabei hatte, acht Schichten. Und als er bei der Fahrt durch Patagonien drei Wochen lang am Gegenwind abprallte wie an einer Mauer, half ihm neben seine Sturheit auch seine Partnerin Susanne, eine Therapeutin aus Augsburg, die Braun kurz vor dem Trip kennen und lieben gelernt hatte. „Der Wind war derart stark, dass ich voller Wut war, einfach nur frustriert. Ich hätte das Rad am liebsten in den Graben geworfen. Susanne, mit der ich fast täglich geredet habe, hat mich daran erinnert, auch an Tagen mit Gegenwind das Schöne am Wegesrand zu sehen und dankbar dafür zu sein“, sagt Braun. „Sie fragte mich, weshalb ich die Reise gemacht habe. Nicht, um etwas zu leisten oder um fixe Pläne umzusetzen, sondern, um mich überraschen zu lassen, um alles, was passiert, zu spüren und zu fühlen. Und sie erinnerte mich auch daran, dass man andere nicht am Telefon volljammern sollte“, erzählt er lächelnd.
Vierzehn Länder durchquerte Darius Braun, von Vancouver in Kanada bis Feuerland in Kanada, und alle nur denkbaren Landschaften: Gebirgspässe und Wasserfälle, Steppen und die Regenwälder des Amazonas, einen Moloch wie Mexiko City, kleinste Dörfer in Nicaragua oder Peru. Er begegnete Tausenden von Straßen, Häusern, Steinen und Menschen in allen möglichen und unmöglichen Zuständen und Formen. Die irrealste, magischste Landschaft? „Salar de Uyuni, die Salzwüste in Bolivien“, sagt Braun sofort. „Eine unendliche weiße Ebene im gleißenden Licht, einfach nur krass.“ Wie viele Weltenbummler stellte er dort sein Stativ auf und lichtete sich nackt auf dem Rad ab. „Das ist dort Kult unter den Radlern“, erzählt er lächelnd.
Zwanzig Medientermine hatte Darius Braun auf seiner Reise, besuchte zahllose Kliniken, in Mexiko und Kolumbien war er sogar Thema in den Nachrichten großer Sender. Die tiefsten Erkenntnisse aber schenkten ihm die Begegnungen mit Menschen. „Was mich am meisten bewegt hat, ist, wie unfassbar hilfsbereit die Menschen auf dieser Welt sind. Fast alle haben das Gute im Sinn. Egal, an welchem Ort ich war, die Menschen haben mich unterstützt.“ In Mexiko etwa habe er einmal zu spät erkannt, dass eine Straße frisch asphaltiert war. „Der Asphalt fräste sich in Reifen und Schutzblech, und fast zeitgleich sprangen alle Straßenarbeiter auf, um mir zu helfen. Sie holten ihre Werkzeuge, halfen mir aus der Patsche und lächelten dabei, als ob ich ihr bester Freund bin.“ Auch die Menschen, die er in den USA traf, standen Braun zur Seite. „Auch jene, die Republikaner wählen, da gab es keine Unterschiede. Nur einen Fehler, den darf man bei ihnen nicht machen: über Politik reden. Als ich erwähnte, dass ich nach Mexiko radle, erklärten mich alle für verrückt. Da sei Drogenkrieg, da werde ich sofort erschossen“, erzählt Braun. „Tatsächlich habe ich mich in Mexiko am wohlsten gefühlt. Da sieht man, was Propaganda anrichten kann, wie sie Angst erzeugt bei Menschen.“
Braun selbst hatte eher mit seiner eigenen Propaganda zu kämpfen, gnadenlosen Glaubenssätzen aus der Kindheit, wie er in seinem Buch „Vom Gegenwind getragen“, aus dem er am 25. Januar bei seinem Vortrag in der Vesperkirche Ravensburg zitieren wird, beschreibt. Kilometer um Kilometer begann er, sie zu entlarven. Sein verbissener Kampf gegen die Folgen des Hirntumors und körperliche und kognitive Defizite habe dazu geführt, dass er sich jahrelang unerbittlich mit anderen verglichen habe. „Ich hatte mich als Junge nur über den Sport definiert. Als der Tumor kam, fraßen mich die Selbstzweifel auf. Statt auf meine Fortschritte zu schauen, ging mein Blick nur auf das, was noch fehlte. Statt stolz zu sein, machte ich mich klein. Egal, wie sehr ich mich anstrengte, es reichte nie. Mein Leben war eine ständige Suche nach Bestätigung, einem Platz, an dem ich mich wirklich zu Hause fühlte“, schreibt Braun. Nicht umsonst sei er wie seine Eltern Lehrer geworden – bis er merkte, dass es nicht mehr passte. „Das Unterrichten und der Umgang mit den Schülern machte mir Spaß, alles Drumherum stresste mich.“
Auf seiner Weltreise wurde ihm schließlich klar, dass er den Menschen von seinem Weg, von seinem Umgang mit Krisen erzählen möchte und davon, wie die Selbstliebe wieder zurückkam zu ihm. Darüber, warum es sich lohnt, niemals aufzugeben. Inzwischen hält Darius Braun Mutmacher-Vorträge und Resilienz-Seminare, die er künftig auch in der Natur anbieten will, in Bewegung, im Dialog und im Austausch.
Am Salzsee in Bolivien habe er eine Art Erweckungserlebnis erlebt, erzählt Braun. „Plötzlich wurde mir klar, wie verbunden ich mit allem war. Verbunden mit etwas Größerem. Mit Gott. Und eins mit der Natur. Wenn ich ein Gefühl als göttlich bezeichnen würde, dann genau dieses. Alle Zweifel verstummen, und an ihre Stelle treten Zuversicht, Vertrauen und Frieden. Ich erkannte: Ich bin nicht allein und war es auch nie. Es gibt nichts mehr zu beweisen. Ich bin wertvoll – nicht durch das, was ich tue, sondern durch das, was ich bin.“